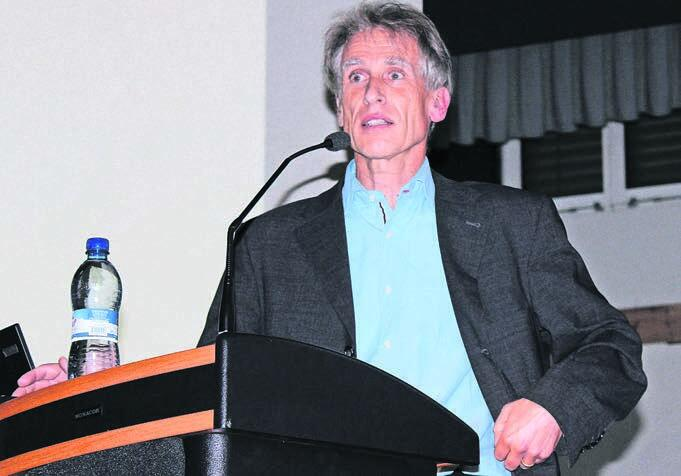Wie Pestizide ins Wasser gelangen
23.10.2020 Region UnterfreiamtWirtschaftsapéro der IG Allmend, der FDP und des Vereins Handwerk & Gewerbe Villmergen und Umgebung
Das Chlorothalonil im Grundwasser geht in der Öffentlichkeit vergessen. Doch es ist ein Thema, das die Gemeinden noch lange beschäftigen wird. Aus diesem ...
Wirtschaftsapéro der IG Allmend, der FDP und des Vereins Handwerk & Gewerbe Villmergen und Umgebung
Das Chlorothalonil im Grundwasser geht in der Öffentlichkeit vergessen. Doch es ist ein Thema, das die Gemeinden noch lange beschäftigen wird. Aus diesem Grund wird in Villmergen darüber informiert.
Chantal Gisler
Es ist ein Thema, das wegen der Coronakrise untergeht. Aber trotzdem ist es brandaktuell. Vor allem für die Gemeinden: Das Grundwasser ist damit belastet und Chlorothalonil in zu hoher Konzentration im Trinkwasser nachweisbar. Seit letztem Jahr ist das Pestizid immer wieder in den Schlagzeilen. Auch in Villmergen wurde der Höchstwert überschritten, sodass die Gemeinde zeitweise über die Hälfte des Trinkwassers aus Wohlen beschaffen musste.
«Gerade wegen der Aktualität haben wir beschlossen, den Wirtschaftsapéro mit dem Vortrag von Christian Stamm durchzuführen», sagt Edwin Riesen, Präsident der FDP-Ortspartei Villmergen und Mitorganisator des Anlasses. Stamm ist stellvertretender Abteilungsleiter Umweltchemie, EAWAG aquatic research in Dübendorf, und hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Gerade wegen der Aktualität ist der gesamte Villmerger Gemeinderat ebenfalls vor Ort.
Im Grundwasser bleibts länger
Wie gelangt das Pestizid ins Grundwasser? Und wieso ist es plötzlich ein Problem geworden? Das erklärt Christian Stamm in seiner Präsentation. «Man muss zwischen zwei Arten von Wasser unterscheiden: den Fliessgewässern, also Flüssen und Bächen, und dem Grundwasser. Die Pestizide gelangen auf unterschiedliche Weisen ins Wasser. In Flüsse meist beim Spritzen durch kleine Tröpfchen, die bis dorthin fliegen. Oder durch Regen, der sie bis in die Kanalisation oder in den nächsten Bach bringt. Dort sind sie aber nur saisonal und relativ kurzzeitig zu finden, da das Wasser weiterfliesst. In Seen werden die Pestizide so verdünnt, dass sie keinen Einfluss haben.» Aber: Landen die Pestizide einmal im Grundwasser, kann es Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sie abgebaut werden.
Aber was genau ist das Problem mit Chlorothalonil? «Bis Ende 2018 gab es kein Problem damit», erklärt Christian Stamm. «Aber seit Anfang 2019 geht man davon aus, dass Chlorothalonil möglicherweise krebserregend ist. Jetzt liegt es an den Produzenten, das Gegenteil zu beweisen.» Aus diesem Grund wurde der Grenzwert im Wasser gesenkt. Weiter hat Chlorothalonil grosse Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften. Zwar handelt es sich dabei um ein Fungizid, ein Pilzbekämpfungsmittel, für wirbellose Tiere ist es aber auch hoch giftig. Das kann einen grossen Einfluss auf das Ökosystem haben. «Die gleiche Konzentration kann ein sehr unterschiedliches Risiko bedeuten», führt Stamm aus.
Der erste Schritt ist getan
Die aktuellen Anforderungen mit dem neuen Grenzwert basieren auf dem Vorsorgeprinzip. «So gesehen war die Welt bis 2018 noch in Ordnung. Seit 2019 gelten Oberflächengewässer und Grundwasser plötzlich als stark belastet.» Aber welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Stamm zeigt einige Möglichkeiten auf. Sie alle haben zwar keinen grossen Einfluss auf die Konsumenten, die im Laden Früchte und Gemüse kaufen. Aber er erklärt, dass alle, einschliesslich Konsumenten, mithelfen können, das Problem in den Griff zu bekommen. Dazu gehört auch weniger Fleischkonsum und weniger Foodwaste. «Das Ziel muss sein, die toxische Belastung zu vermindern.» Das ist kein neues Thema, schon vor 20 und 25 Jahren hat man in der Schweiz darüber gesprochen. Allerdings ging es damals noch um andere Pestizide.
Für die Gemeinden dürfte vor allem die Belastung des Grundwassers weiterhin ein Thema sein. Denn dieses fliesst nicht einfach weg und kann sich nicht mit anderen pestizidfreien Gewässern vermischen. «Das Problem werden wir nächstes Jahr bestimmt auch noch haben.» Ein erster Schritt sei aber schon mal getan, indem das Wasser immer wieder getestet wird, sodass man sich ein genaues Bild machen kann. Denn so kann man gemeinsam Lösungen erarbeiten, mit denen im besten Fall auch die Landwirte zufrieden sind.